Category: Homepage

Was ist Customer Journey Mapping (CJM)?
(Potentielle) KundInnen durchlaufen mehrere Stationen vom Beginn Ihrer Suche bis hin zur Conversion. Das bekannte AIDA Modell beschreibt die Stationen von der Attention, über den Interest zu Desire bis hin zur gewünschten Action. Customer Journeys – und deren Mapping – sind die logische Weiterentwicklung dieses seit Jahrzehnten im Marketing bewährten Modells. Diese sogenannten Kundenreisen sind…
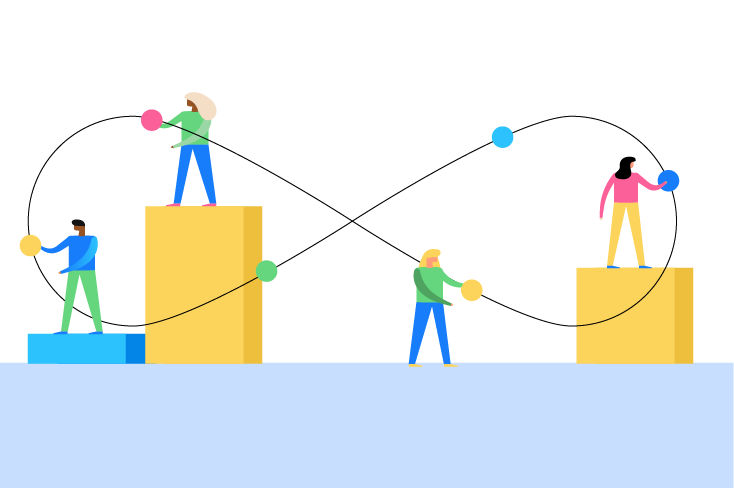
Was ist der Unterschied zwischen Touchpoints und Channels im CJM?
Diese beiden Begriffe werden öfters vermischt, haben dennoch unterschiedliche Bedeutungen im Customer Journey Mapping. Bei einem Touchpoint handelt es sich grundsätzlich um eine Interaktion seitens KundInnen/UserInnen mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Das muss natürlich nicht immer online sein. Das kann z.B. ein Telefonat mit dem Support sein, ein Besuch auf der Website, die Nutzung…

Personas – warum brauchen wir Personas auch im Online Marketing?
Personas werden in der Informations- und Kommunikationstechnologie bereits seit den 1980er Jahren erfolgreich eingesetzt und erfreuen sich aktuell aufgrund des Booms von Design Thinking oder agilen Methoden besonderer Beliebtheit. Grundsätzlich sollen Personas allen Beteiligten ermöglichen, die Bedürfnisse, Handlungen und Herausforderungen von NutzerInnen zu verstehen. Personas unterstützen zum Beispiel Marketingteams bei der Erstellung einer (Online) Marketing…

Agilität für jedes Unternehmen?
Agilität ist eines DER Buzzwords schlechthin in vielen globalen, großen aber auch lokalen, kleinen Unternehmen. Was genau aber bedeutet Agilität? Muss, soll und kann jedes Unternehmen agil sein? Diese Fragen möchte ich in diesem Blog-Beitrag genauer unter die Lupe nehmen. „Agilität befähigt Organisationen, schnell und flexibel, antizipativ und initiativ, effektiv und effizient, proaktiv und reaktiv…

Whats the difference between AR, VR and MR?
The terms Augmented Reality, Virtual Reality and Mixed Reality (yes, that also exists) are mixed up often especially in the professional area or it is not always clear what exactly differentiates them. In this short and compact blog post I’m trying to explain the differences. DEFINITION Virtual Reality (VR): immerses users in a fully artificial…

Was bedeutet eigentlich Native Advertising?
Native Advertising ist auch in Österreich angekommen. Man merkt es unter anderem daran, dass dieses Thema mittlerweile auf keiner (Digital-)Marketingkonferenz mehr fehlt. Doch wie ist Native Advertising eigentlich definiert, welche Best Practice Beispiele dazu gibt es und wie grenzt es sich von ähnlichen Werbeformen ab?
Methoden der Usability-Evaluation: Einleitung
In den vergangenen Jahrzehnten wurden diverse Methoden der Usability-Evaluation entwickelt. Die Mehrheit hat das gemeinsame Ziel, Aussagen über die Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit über Produkte durch deren Benutzung zu treffen. Aufgrund der unterschiedlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden, muss mit Berücksichtigung der Ziele, dem Status des Projektes, vorhandenem Wissen und dem Zugang zu den…

Die Nutzungsfreude – Joy-of-Use
Die Fokussierung rein auf die ziel- und aufgabenorientierte Usability reicht nicht aus. Die Faktoren Spaß und Freude müssen berücksichtigt werden. Diese haben positive Auswirkung auf Akzeptanz und Zufriedenheit von Produkten und Systemen. (Vgl. Burmester/Hassenzahl/Koller, 2002, S. 33) Eine mögliche Definition von Joy-of-Use lautet folgendermaßen: „Joy of use eines Software-Produkts ist das freudvoll-genussreiche Erleben der Qualität der…

Was bedeutet User-Experience (UX)?
Eine im Jahr 2011 durchgeführte Studie unter 24 Usability-ExpertInnen aus drei Ländern (China, Dänemark und Indien) fasst den Begriff Usability weitreichender und unterscheidet ihn nicht von User-Experience. (Vgl. Hertzum/Clemmensen, 2012, S. 26ff. DIN EN ISO 9241-210, 2010, S. 3.) Dennoch gibt es per Definition Unterschiede: Durch User-Experience-Design erhalten NutzerInnen ein Produkt oder System mit ihren gewünschten Anforderungen…

Definition von Usability
Der Begriff Usability stammt aus einer Zeit, als Produkte komplexer wurden und der technologische Fortschritt zu einer Steigerung des Produktangebots führte. Durch den Anstieg wurden zwar zahlreiche Funktionalitäten unterstützt, allerdings war die Nutzung eingeschränkt. Heutzutage ist dieser Begriff omnipräsent in der Mensch-Computer-Interaktion. Es existieren unterschiedliche, teilweise einheitliche, aber auch widersprüchliche Definitionen von Usability. Ein genaues…